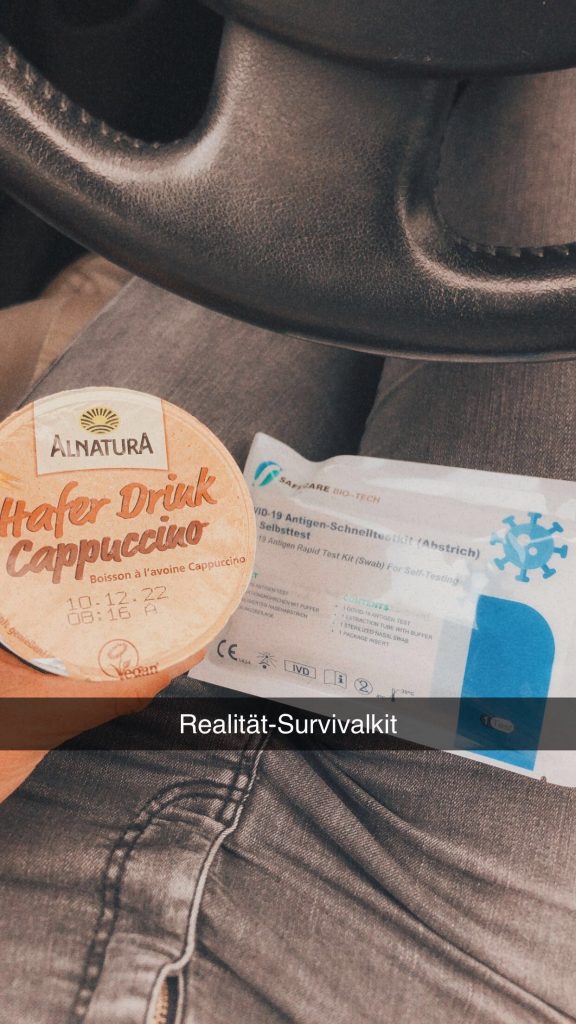In dem Buch-Podcast meines Vertrauens wurde vor Kurzem eine interessante These aufgestellt: wir sind sowas wie die Wilde Hühner-Generation. Die, die sich an dunklen Tagen unter die Decke verzieht und zum 100. Mal Fuchsalarm ansieht, um dann folgenden Satz auswendig mitzusprechen:“Manchmal stell ich mir vor, dass man so eine schöne Zeit wie jetzt einfach in ein Marmeladenglas stopfen kann. Und wenn es einem später mal schlecht geht, dann öffnet man es und riecht daran.“
Ein Blick auf TikTok und drei Klaviertöne des zugehörigen Lieds, und ich muss sagen: I’m in. Es muss ja nicht unbedingt ein Glas sein. Und auch nichts Duftendes. Man könnte auch psychologisch-wissenschaftlich von gewissen Resilienzkonzepten sprechen. Aber das mit dem Später aufschrauben ist ein schönes Bild, und es klingt durchaus rentabel in Zeiten, in denen man pro 15 Minuten Tagesschau eigentlich mindestens einen weiteren beruhigenden Kinderfilm zur Kompensation heranziehen muss.
Wahrscheinlich braucht es keinen Tiktok-Post und kein luftdichtes Einmachglas, aber nutzen wir diesen gewitterigen letzten Juni-Abend doch für einen kurzen Rückblick auf die letzten 30 Tage. Vorzugsweise auf die Guten davon.
Eines steht fest: es hat jetzt schon öfter die Sonne geschienen als den gesamten letzten Sommer über. Benutzt mich aber nicht als vertrauenswürdige Meteorologin, dafür bin ich dem Wetter gegenüber doch etwas subjektiv eingestellt. So oder so habe ich viele Läufe und Grillabende und Sternennächte unter einem warmen, freien Himmel verbracht, und es sehr geliebt. Gibt es eine wissenschaftliche These dafür, dass im Sommer alles besser ist?
Eine Pause für die Angst
Mein ganzer Juni war geprägt von einem wichtigen Ereignis aus der Reihe „After-Corona Revivals“. Drei ganze Jahre mussten wir darauf warten, bis wir endlich wieder das Pfingstzeltlager der Sportkreisjugend Sigmaringen veranstalten durften. Ich habe diese drei Jahre damit verbracht, in Erinnerungen zu versinken, der leeren Lagerwiese sehnsuchtsvolle Besuche abzustatten und dabei noch sehnsuchtsvoller die Zeile There’s a Green Hill far away, I´m going back there one fine Day aus dem Glastonbury Song zu rezitieren. Könnt ihr euch vorstellen, wie schön dieser one fine Day, der 04. Juni 2022, war? Na gut, ich habe es nicht vermisst, Zeltplanen zu falten und mein Bett mit Ameisen zu teilen. Aber der Rest dieser acht Tage? Unvergleichlich. Noch nie habe ich unser Betreuerteam so stark und gemeinschaftlich erlebt. Und vielleicht haben wir alles noch ein bisschen mehr geschätzt als sonst.
In einem Zeltlager zu leben fühlt sich an, wie von einer Blase umgeben zu sein, jenseits derer die Welt mit ihren normalen Regeln und Problemen liegt. Was soll ich sagen – ich habe sie überhaupt nicht vermisst. Es hat mir so viel bedeutet, diesen 130 Kindern ein bisschen davon zurückzugeben, was ihnen die letzten zwei Jahre verwehrt war: Abenteuer, Unbeschwertheit, Leichtigkeit.
An einem Abend erzählte mir ein Mädchen aus dem Zelt, das ich betreut habe, dass sie über den Krieg nachdenkt. Ob er auch zu uns kommt. Und was wir dann machen würden. Dieses Mädchen war sieben oder acht Jahre alt. Am liebsten hätte ich ihr versprochen, dass sie sich darüber keine Sorgen machen muss. Dass auf keinen Fall irgendetwas passieren wird. Aber erstens ist eine Angst ein Monster, das sich noch von keinem leicht gesagtem „Du brauchst gar nicht da sein“ vertreiben lassen hat. Zweitens, und das weiß dieses Mädchen genauso gut wie ich, gibt es keine Versprechen. Es gibt eigentlich nur Zuversicht, und das Vertrauen in uns selbst, dass wir die Angst aushalten können. Und das, wovor wir Angst haben, auch. Wenn Ängste berechtigt sind, und wenn sie sich nur von der kleinsten Wahrscheinlichkeit nähren, gehen sie manchmal nicht weg. Dann ist es besser, sie da sein zu lassen, ohne dass sie alles übernimmt. Das habe ich diesem Mädchen gesagt: dass sie diese Angst haben darf, und dass sie nicht alleine ist, aber dass die Angst auch nicht alles von ihr ist. „Heute Abend am Lagerfeuer kann uns nichts passieren. Da hat die Angst Pause.“ So viel konnte ich ihr versprechen. Und so haben wir am Lagerfeuer einen Moment fürs Marmeladenglas gesammelt, damit wir es aufschrauben können, wenn die Angst sich wieder meldet. Dafür ist es ja da.
Anscheinend war die Blase um das Zeltlager also doch nicht ganz luftdicht. Und leider auch ziemlich zeitlich begrenzt. Seitdem versuche ich, dankbar auf die vielen, vielen hellen Momente zu sehen, anstatt ernüchtert die noch mehr Tage bis zum nächsten Jahr zu zählen. Das Wichtigste ist: es ist passiert. Und jedes Mal, wenn ich etwas nach der Pandemie zum ersten Mal mache, fühle ich mich wieder ein bisschen mehr wie ich selbst.
In einer anderen Welt
Glücklicherweise folgte wenige Tage danach direkt der nächste Trip in ein Paralleluniversum. Dieses Mal in eins mit ein bisschen mehr Alkohol und Glitzer. Denn auch das Southside-Festival hat sein Comeback gefeiert. Praktisch: ich habe die Karte dafür 2019 gekauft, mit Geld, zu dem ich absolut keinen Bezug mehr habe, nachdem ich mir zum Glück immer noch meine wöchentliche Ration Pesto leisten kann. Das Ticket fühlte sich somit an wie ein Geschenk von Vergangenheits-Ich. Nett von ihr! Drei Erkenntnisse von diesem Festival: Klokabinen sind ein kostbares Gut, Wasser noch viel kostbarer, und ich bin offenbar abgehärtet von meiner Zeit auf Sizilien, was die Hitze betrifft. Aber Spaß beiseite: die Situation bezüglich der mangelnden Wasserstellen und das Flaschenverbot auf dem Konzertgelände bei 33 Grad im Schatten waren fahrlässig und gefährlich. Ich bin dankbar, dass niemandem, dem ich kenne, etwas passiert ist. Abgesehen von Hitze von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang war die Zeit nämlich hauptsächlich magisch. Ich habe keine Worte für das Gefühl, mit tausenden Menschen in einer Menge zu stehen und dasselbe Lied zu singen. Auf der Bühne steht ein Künstler oder eine Künstlerin und du siehst hin und denkst „Ohne dich hätten sich die unterschiedlichsten Momente meines Lebens anders angefühlt“. Hauptsächlich leerer. Musik ist etwas so elementar wichtiges auf dieser Welt. Sie kann Leben retten. Und Momente festhalten, so scharf und farbig, dass man auch Jahre später wieder in ihnen atmet und fühlt. Provinz, Tom Gregory, Dermot Kennedy, Martin Garrix, The Killers, Twenty One Pilots – abgesehen von Kings of Leon, bei denen wir uns nach 30 Minuten gefragt haben, ob das eigentlich nur die Vorband ist, habe ich sie alle geliebt.
Und dann war da noch das Giant Rooks-Konzert.
Wenn ich jetzt anfange, darüber zu schreiben, höre ich nie wieder auf. Deswegen muss ich mich wohl oder übel auf folgendes beschränken: mein Marmeladenglas ist voll mit einer einzigen Stimme und einer einzigen Band – und bitte hört sie euch an:
https://open.spotify.com/embed/track/3am2Y5mLijaA94DaKBX1QA?utm_source=generator
(Und glaubt mir, diese Auswahl ist mir sehr schwer gefallen, weil ein Song besser als der andere ist, und ja ok, ich höre jetzt wirklich auf)
Wir sind Alban
Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass nach drei Jahren zum ersten Mal wieder etwas stattfand, aber: am Ende des Junis fand auch der Rummel wieder statt. Der Rummel ist ein sagenumwobenes Ereignis, bei dem Sterne vom Himmel fallen oder sowas, zumindest für diejenigen in unserem Wohnheim, die erst nach dem letzten Rummel eingezogen sind. Drei Jahre lang haben wir von allen „älteren“ MitbewohnerInnen gehört, wie besonders diese drei Tage Wohnheim-Party sind. Jetzt haben wir es endlich erlebt.
In unserem Wohnheim gab es in den letzten Monaten viele Momente, die absolut nicht reif fürs Marmeladenglas waren. In diesem verblendeten, gefilterten Monatsbericht lasse ich sie elegant aus, und schreibe lieber über das hier: 48 Stunden Zusammensein, beim klassischen Konzert, beim Fußballturnier, bei der Fahrradversteigerung, in der Dreisam, im Biergarten, beim Weißwurstfrühstück, beim Volleyballturnier, beim Entenrennen und beim Gottesdienst. Dieses Wochenende waren wir ein großes Haus. Na gut, Stock 23 und Stock 11 müssen sich traditionell immer noch batteln und der Zweierbau hat neuerdings eine eigene Hymne, aber hauptsächlich waren wir einfach das Alban. Und davon war mein Herz sehr voll, als wir abends alle im Biergarten standen und so laut sangen, dass die Nachbarn es wahrscheinlich noch hörten. Praktischer Weise sind wir aber öfter sehr laut, sodass sie den Text wahrscheinlich schon auswendig können: Ja, ich bin Alban, und stolz darauf. Dafür nehm ich alles andere gern in Kauf. (Wir haben natürlich nicht alles in Kauf genommen, schon gar keine Lärmschutzbeschwerde, ich schwöre, es war vor 22:00 Uhr)
Am Ende dieses Wochenendes hat sich für mich nur noch eine Frage gestellt: wie soll ich es schaffen, diesen zauberhaften Ort, mein Zuhause, nach dem es sich endlich wieder angefühlt hat, in weniger als drei Monaten zu verlassen? Wir werden sehen.
Touchdown to reality
Und dann war die Staffel der „After-Corona Revivals“ mit all ihrer Magie vorbei, und mein Alltag kehrte zurück. Äußerst unbefriedigend, aber nötig. Mein Studium wartet nämlich seit längerem darauf, die Beachtung zu bekommen, die es braucht. Deswegen ist es gerade auch 18:33 Uhr und ich sitze immer noch in der good old UB. Dazwischen nutze ich meine neu erworbene Saisonkarte im Strandbad (mit viel Fantasie fühlt es sich an wie ein Privatpool) und suche nach WG-Zimmern in Padua. (Wusstet ihr, dass es im Italienischen drei verschiedene Wörter für Zimmer gibt, die sich alle minimal unterscheiden, und auch sonst läuft alles reibungslos)
Sehr viel gerade ist aufregend. Nicht alles davon auf die gute Art. Aber ich bin dankbar für jeden einzelnen dieser Marmeladenglasmomente.
Ich hoffe, ihr hattet sie auch. Hört auf jeden Fall nicht auf, danach zu suchen. Es lohnt sich.
Marmeladenglasmomente